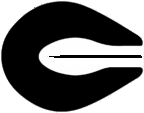Das Gehirn ist keine statische Masse, sondern unterliegt aufgrund der unzähligen neuen Erfahrungen, die wir tagtäglich sammeln, kontinuierlichen Veränderungen. Diese Fähigkeit des Gehirns sich zu verändern und anzupassen, nennt man Neuroplastizität (engl. neural plasticity). Was es damit auf sich hat und warum Kenntnisse darüber auch für das Klavierspielen interessant sein können, erfährst du in diesem Beitrag.
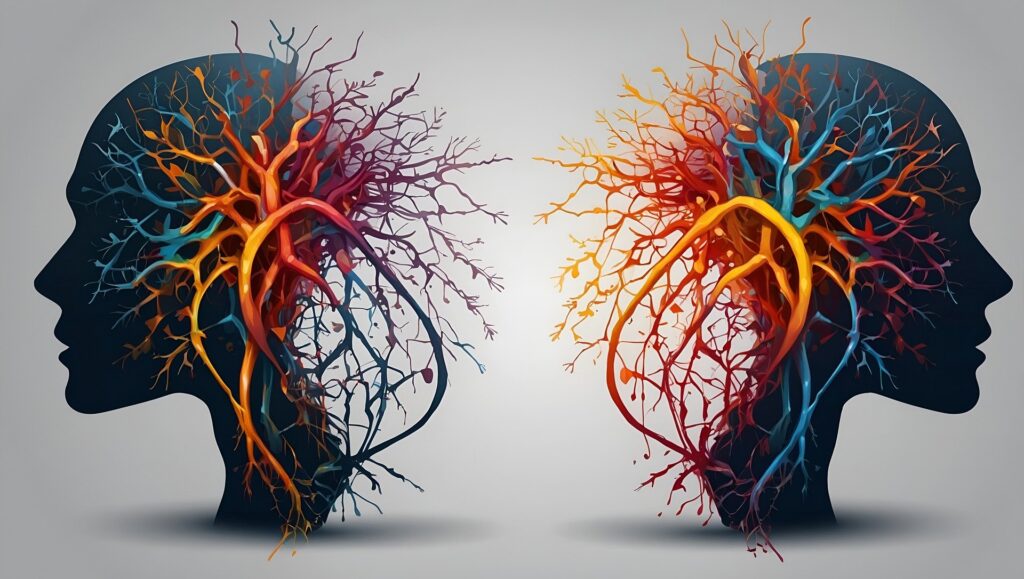
Bei Lernen denken wir oft an Personen, die über einen Stapel von Büchern gebeugt sind, um sich neues Wissen anzueignen. Aber auch das Erwerben von Fähigkeiten wie Fahrradfahrern, Autofahren oder Klavierspielen stellt eine Form des Lernens dar. Beim Klavierspielen und dem Lernen von neuen Stücken oder pianistischen Fähigkeiten sind viele komplexe Prozesse involviert.
Die Grundlage jeglicher Art des Lernens liegt in der eingangs genannten Neuroplastizität. Wäre das Gehirn statisch, könnten wir weder neue Informationen aufnehmen oder neue Fähigkeiten erlenen, noch könnten wir Dinge wieder vergessen. Das Gegenteil ist jedoch der Fall, denn das Gehirn ist sehr plastisch und passt sich über die gesamte Lebensspanne an Gegebenheiten der Umgebung an1. Verschiedene Faktoren und Elemente sorgen dafür, dass sich sowohl Strukturen im Gehirn als auch die Verbindungen zwischen Gebieten im Laufe der Zeit verändern können2.
Warum regelmäßiges Üben so wichtig ist
In diesem Zusammenhang gibt es eine bekannte Aussage, die vom Psychologen Donald Hebb aus dem Ende der 1940er Jahre stammt:
„What fires together, wires together“ (Donald Hebb)
Damit ist gemeint, dass Synapsen, die zeitgleich „feuern“ (also zeitgleich aktiv sind) für eine stärkere Verbindung zwischen den entsprechenden Nervenzellen sorgen. Die Verbindung zwischen zwei Neuronen nimmt demnach immer dann an Stärke zu, wenn sie gleichzeitig aktiv sind1. In diesem Zusammenhang bilden sich in der Folge bestimmte Zellverbände, die durch gemeinsame, synchrone Aktivität die Verbindungen untereinander stärken2.
Regelmäßiges und häufiges Üben am Klavier führt folglich dazu, dass die involvierten Neuronen stärker untereinander verbunden sind. Die vermehrte Ausführung bestimmter Bewegungen und das vermehrte Benutzen bestimmter Körperteile (z.B. der Finger) führt darüber hinaus zu einer stärkeren Repräsentation dieser Bereiche in den entsprechenden kortikalen Arealen im Gehirn 2.
Diese Repräsentationen kann man sich wie eine Art Landkarte vorstellen, auf denen häufig beanspruchte Körperteile ausgedehnter und detaillierter dargestellt sind als andere. Das heißt, dass man regelmäßiges Üben nicht durch eine einzelne, lange Übe-Session ersetzen kann. Denn auch wenn man die Finger beim Klavierspielen einmal sehr lange beansprucht, hat man sie trotzdem nicht häufig genutzt. Dementsprechend sind das für das Gehirn keine wichtigen Bewegungen, die im Alltag ständig ausgeführt werden müssen. Das Gehirn misst diesen Bewegungen demnach keine so wichtige Rolle zu.
Veränderungen im Gehirn setzen schnell ein
Beim Erlernen von komplizierten motorischen Bewegungsabfolgen, wie es beim Klavierspielen der Fall ist, handelt es sich um implizites Lernen, das langsam, unbewusst und kontinuierlich erfolgt1. Dies kann beim Üben manchmal zu Frustrationen führen, wenn nicht immer sofort Fortschritte zu beobachten sind. Tatsächlich treten Veränderungen im Gehirn jedoch schon nach kürzester Zeit ein, auch wenn du beim Üben möglicherweise noch keine großen Verbesserungen beobachten kannst. Bereits nach wenigen Tagen zweihändigen Klavier-Trainings hat man Veränderungen der Plastizität des Gehirns festgestellt3.
Übereinstimmend mit den vorher geschilderten Informationen, hat man in zahlreichen Studien festgestellt, dass es aufgrund jahrelangen, intensiven Klavierspiels und Übens zu strukturellen und funktionellen neuroplastischen Veränderungen in kortikalen und subkortikalen Gebieten im Gehirn kommt, die mit sensorischen, kognitiven und motorischen Fähigkeiten assoziiert werden4. Das Ausmaß des Übens beeinflusst die Größe, das Ausmaß und die Geschwindigkeit der Veränderungen im Gehirn6.
Zusammenfassung
Was kann aus diesen Erkenntnissen nun aber für die Praxis von Klavierlehrern- und Schülern gezogen werden? Zunächst kann man festhalten, dass das Klavierspielen hinauf bis ins hohe Alter erlernt werden kann. In zahlreichen Studien ist nachgewiesen worden, dass das Gehirn bis in ein hohes Alter plastisch, also veränderbar bleibt, und demnach neue Fähigkeiten erworben werden können7. Zudem wirkt sich das Klavierspielen insbesondere in diesem Altersbereich positiv auf viele Aspekte der mentalen Gesundheit aus (wenn du mehr darüber erfahren möchtest, schaue dir diesen Artikel an).
Vor allem aber erklären die neuroplastischen Eigenschaften des Gehirns, warum es so wichtig ist, regelmäßig zu üben. Die Regelmäßigkeit führt dazu, dass verschiedene Gebiete im Gehirn stärker miteinander verbunden werden und somit die Kommunikation zwischen diesen besser funktioniert7. Das Ausmaß des Übens trägt maßgeblich zum Ausmaß und der Geschwindigkeit der Veränderungen im Gehirn bei, was beispielsweise anhand des Volumens der grauen Substanz in unterschiedlichen Arealen beobachtet werden kann8. Diese Veränderungen treten bereits ein, bevor du beim Spielen beobachtbare Fortschritte erkennen wirst.
Wenn du beim Üben am Ball bleibst, führen sie aber dazu, dass du nach einiger Zeit dann auch beim Spielen die Verbesserungen wahrnehmen kannst. Das Gehirn schätzt Bewegung als wichtig für den Alltag ein, die häufig und regelmäßig ausgeführt werden. Wird das Üben zu einer regelmäßigen Gewohnheit, räumt das Gehirn dem Klavierspielen einen größeren Raum ein. Dies spiegelt sich in sogenannten kortikalen Repräsentationen wieder. Das kann man sich wie eine Landkarte vorstellen, auf denen häufig beanspruchte Körperteile ausgedehnter und detaillierter dargestellt sind als andere.
Auf diesem Blog erscheinen immer wieder Artikel, die sich mit den unterschiedlichsten Themen des Klavierspielens und Klavierunterrichts auseinandersetzen.
1. Spitzer M. Musik im Kopf : Hören, Musizieren, Verstehen und Erleben im neuronalen Netzwerk [Internet]. Bd. 2. Auflage. [S.l.]: Schattauer; 2014 [zitiert 16. Februar 2024]. Verfügbar unter: https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=shib&db=nlebk&AN=1988327&lang=de&site=eds-live&scope=site&custid=s6068579
2. Karnath HO, Thier P, Herausgeber. Neuropsychologie: mit 24 Tabellen ; [neu: Glossar]. 2., aktualisierte und erw. Aufl. Heidelberg: Springer Medizin; 2006. 763 S. (Springer-Lehrbuch).
3. Houdayer E, Cursi M, Nuara A, Zanini S, Gatti R, Comi G, u. a. Cortical Motor Circuits after Piano Training in Adulthood: Neurophysiologic Evidence. PLOS ONE. 16. Juni 2016;11(6):e0157526.
4. Furuya S, Altenmüller E. Flexibility of movement organization in piano performance. Front Hum Neurosci [Internet]. 2013 [zitiert 15. Februar 2024];7. Verfügbar unter: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2013.00173
5. Choi US, Sung YW, Ogawa S. Brain Plasticity Reflects Specialized Cognitive Development Induced by Musical Training. Cereb Cortex Commun. 1. Januar 2021;2(2):tgab037.
6. Schlaug G, Forgeard M, Zhu L, Norton A, Norton A, Winner E. Training-induced Neuroplasticity in Young Children. Ann N Y Acad Sci. Juli 2009;1169:205–8.
7. Jünemann K, Engels A, Marie D, Worschech F, Scholz DS, Grouiller F, u. a. Increased functional connectivity in the right dorsal auditory stream after a full year of piano training in healthy older adults. Sci Rep. 15. November 2023;13(1):19993.
8. Vaquero L, Hartmann K, Ripollés P, Rojo N, Sierpowska J, François C, u. a. Structural neuroplasticity in expert pianists depends on the age of musical training onset. NeuroImage. Februar 2016;126:106–19.