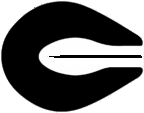In diesem Blog-Artikel stelle ich dir wissenschaftliche Erkentnisse vor, auf die sich die Entwicklung des Übe-Tagebuchs stützt. Falls du also mehr über die Hintergründe erfahren möchtest, lies dir gerne diesen Beitrag durch. Zum kostenlosen Download gelangst du hier.
Zielgerichtetes Üben
Die Kenntnisse und der Leistungsstand am Instrument hängen nicht nur mit dem Üben zusammen, auch Aspekte wie Genetik, Umwelt, Persönlichkeit und Passion/Motivation spielen eine Rolle. Dennoch können rund 30% des Leistungsstandes auf zielgerichtetes Üben (deliberate practice) und die damit verbrachten Stunden zurückgeführt werden1,2,3. Üben spielt also eine zentrale Rolle, wenn es darum geht, Fortschritte am Instrument zu erzielen.
Bei einem Auftritt spielt man Stücke durch. Unsicheren oder schwierigen Stellen begegnet man nur einmal. Daher ist es wichtig, sich Gedanken über noch vorhandene Schwachstellen zu machen und an diesen gezielt und strukturiert zu arbeiten, um sich zu verbessern5.
Wenn die Stücke und Konzepte komplexer werden, reicht es nicht aus, einfach nur mehr oder länger zu spielen, um sich zu verbessern2. Eine sinnvolle Übe-Einheit zeichnet sich durch folgende Charakteristiken aus:
- Zielorientierung
- gerichtete Aufmerksamkeit (Fähigkeit, die Aufmerksamkeit auf eine
bestimmte Sache/einen bestimmten Aspekt zu fokussieren) - selbst-regulatorische Fähigkeiten (das eigene Verhalten wird in
Hinblick auf selbst gesetzte Ziele selbst gesteuert und angepasst) - zielgerichtete Übe-Strategien (verschiedene Strategie, die zur
Erreichung des selbst gesetzten Zieles angewandt werden)
Wenn diese Charakteristiken nicht vorhanden sind, hat die Übe-Zeit
keinen Zusammenhang mit dem musikalischen Erfolg und es sind keine
Verbesserungen beobachtbar2
Wenn diese Charakteristiken nicht vorhanden sind, hat die Übe-Zeit keinen Zusammenhang mit dem musikalischen Erfolg und es sind keine Verbesserungen beobachtbar2.
Übe ich ziel- und orientierungslos, macht es demnach kaum einen Unterschied, ob ich 30 Minuten oder 2 Stunden übe. 1 Stunde zielgerichtetes Üben ist also mit viel größeren Fortschritten verbunden, als 3 Stunden zielloses Üben.
Ziele
Ziele helfen dabei, die Aufmerksamkeit auf bestimmte Aspekte zu legen. Darüber hinaus zeigen Studien, dass Feedback in Bezug auf das Erreichen der Ziele die Motivation verstärken kann6.
Die in diesem Übe-Tagebuch verwendete Methode zur Zielsetzung geht insbesondere auf die SMART Methode von Peter Drucker zurück7. Etwas später im Heft wird diese Methode näher vorgestellt und es werden einige Beispiele angeführt, an denen man sich orientieren kann, um die Ziele selber zu formulieren.
Damit Ziele zu einer Leistungssteigerung führen, sollten diese nach der Zielsetzungstheorie von Latham und Locke, spezifisch und herausfordernd sein. Außerdem muss die Person über die nötigen Fähigkeiten und Ressourcen verfügen. Das bedeutet, dass zum einen genügend Zeit zur Verfügung steht, aber z.B. auch, dass das aktuelle Niveau nicht zu weit von den Herausforderungen eines Stückes entfernt ist.
Des Weiteren muss die Person die Aufgabe als sinnvoll erleben, sich die Aufgabe zutrauen und das Ziel als verbindlich erachten. Besonders wichtig sind zudem Rückmeldungen über den Zielfortschritt9. Es ist natürlich gut zu wissen, ob man dabei ist, ein Ziel zu erreichen oder ob man davon noch weit entfernt ist.
Ein Ziel steuert unser Verhalten und lässt uns Erfahrungen sammeln, indem wir bestimmte Situationen aufsuchen oder vermeiden. Wenn ich z.B. das Ziel habe, diese Woche einen spezifischen Abschnitt eines Stückes neu zu lernen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich öfters an das Klavier gehe und übe, größer, als wenn ich mir kein Ziel gesetzt habe9.

Reduktion von Stress
Das Setzen von Zielen kann Stress reduzieren, da es einem das Gefühl gibt, Kontrolle über die anstehenden Aufgaben zu haben. Wenn es Klarheit darüber gibt, was zu erledigen ist und wie es zu erledigen ist (indem man durch die Wochenübersicht alles in kleine Schritte unterteilt), ist die Wahrscheinlichkeit geringer, sich von den ganzen Verpflichtungen erdrückt zu fühlen15.
Wie lange sollte ich üben?
Wie viel Zeit man zum Üben hat hängt natürlich von verschiedenen Faktoren ab. Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen kann zielgerichtetes Üben am Besten für 1-2 Stunden aufrecht erhalten werden. Alles was über 2 Stunden hinaus geht, bietet verhältnismäßig kleinere Erfolge und über 4 Stunden konnten verhältnismäßig keine großen Verbesserungen mehr beobachtet werden5. 1-2 Stunde sind demnach also der Idealfall. Auch 30 min. sind klarerweise sehr wertvoll, werden aber natürlich mit langsameren Fortschritten verbunden sein. Alles was unter 30 min. geht, wird zwar auch Verbesserungen mit sich bringen, allerdings werden diese kleiner ausfallen und langsam eintreten.
Motivation
Drei wichtige Konzepte aus der Motivationspsychologie, auf welchen auch die Entwicklung des Übe-Tagebuchs basiert, sind: Leistungsmotivation, intrinsische Motivation, Selbstwirksamkeit
Bei der – für uns relevanten – Leistungsmotivation handelt es sich um die besterforschte Motivationsform. Als Urheber dieses Forschungszweigs gelten McClelland und Atkinson. Im Alltag spricht man von „Erfolgserlebnis“, der Anreiz der Zielerreichung besteht also darin, etwas Anspruchsvolles gemeistert zu haben.
Dieses Gefühl entsteht dabei nur, wenn das Ergebnis auf die eigenen Fähigkeiten und nicht auf externe Faktoren zurückgeführt wird10.
Zudem wird zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation unterschieden. „Intrinsisch motiviert“ bedeutet, dass etwas um seiner selbst willen geschieht. Wenn ich z.B. aufgrund der Freude am Spielen selbst ans Klavier setze, dann wäre das intrinsisch motiviert. Wenn ich mich hingegen ans Klavier setze, da ich dafür eine externe Belohnung bekomme, dann wäre das extrinsisch motiviert10.
Nach Deci und Ryan gibt es 3 psychologische Grundbedürfnisse, die als universell gültig angesehen werden und die für die Entstehung von intrinsischer Motivation erfüllt sein müssen:
- Autonomie: selbst Urheber der eigenen Handlungen sein und über diese im Einklang mit den eigenen Werten und Interessen bestimmen
- Kompetenz: das Gefühl, wirksam zu sein, sich weiterzuentwickeln und Aufgaben/Ziele erfolgreich zu bewältigen
- soziale Eingebundenheit: das Gefühl, soziale Beziehungen zu anderen Menschen zu haben und sich in einem unterstützenden sozialen Umfeld zu befinden11
Ein zentrales Konzept in der Motivationspsychologie spielt außerdem die sogenannte Selbstwirksamkeit12. Sie beschreibt die Überzeugung, eine Situation mit den eigenen Fähigkeiten und Ressourcen bewältigen zu können. Insbesondere bei Herausforderungen und Hindernissen, sorgt eine hohe Selbstwirksamkeit dafür, dass trotzdem weiter an der Erreichung des Ziels gearbeitet wird und eine Person nicht so schnell aufgibt12.
Aufgrund dieser Erkenntnisse aus der motivationspsychologischen Forschung, findest du deshalb ganz am Ende der Wochenübersicht auch das Feld, in welches du die Fortschritte und das Feedback einträgst. Es soll klar herauskommen, dass sich etwas verbessert hat und, dass diese Verbesserungen durch das eigene Üben erreicht worden sind (Autonomie). Das Festhalten der Ziele und Fortschritte führt darüber hinaus dazu, dass man sich selbst als kompetent und effektiv bei der Zielerreichung erlebt. Das steigert wiederum die Selbstwirksamkeit, was sich positiv auf die Motivation auswirkt.

Selbstreguliertes Lernen und Routine
Selbstregulation spielt eine große Rolle beim Lernen. Es beinhaltet u.a. das Aufstellen von Zielen, das Verfolgen der Fortschritte und letztlich die Selbst-Evaluation der “Leistung”12.
Die Grundlage jeglicher Art des Lernens liegt in der sogenannten Neuroplastizität. Wäre das Gehirn statisch, könnten wir weder neue Informationen aufnehmen oder neue Fähigkeiten erlenen, noch könnten wir Dinge wieder vergessen. Das Gegenteil ist jedoch der Fall, denn das Gehirn ist sehr plastisch und passt sich über die gesamte Lebensspanne an Gegebenheiten der Umgebung an13.
In diesem Zusammenhang gibt es eine bekannte Aussage, die vom Psychologen Donald Hebb aus dem Ende der 1940er Jahre stammt:
„What fires together, wires together“ (Donald Hebb)
Damit ist gemeint, dass Synapsen, die zeitgleich „feuern“ (also zeitgleich aktiv sind) für eine stärkere Verbindung zwischen den entsprechenden Nervenzellen sorgen. Die Verbindung zwischen zwei Neuronen nimmt demnach immer dann an Stärke zu, wenn sie gleichzeitig aktiv sind13. In diesem Zusammenhang bilden sich in der Folge bestimmte Zellverbände, die durch gemeinsame, synchrone Aktivität die Verbindungen untereinander stärken14.
Regelmäßiges und häufiges Üben am Klavier führt folglich dazu, dass die involvierten Neuronen stärker untereinander verbunden sind. Bewegungen, welche oft ausgeführt und demnach „benötigt“ werden, werden vom Gehirn als relevant und wichtig für den Alltag eingestuft. Deshalb kann man regelmäßiges Üben nicht durch eine einzelne, lange Übe-Session ersetzen14.
Warum extra aufschreiben?
Wenngleich es noch nicht viele Untersuchungen hierzu gibt, legen Ergebnisse nahe, dass das Aufschreiben von Zielen eher dazu führt, diese auch umzusetzen. Das scheint daran zu liegen, dass das Gehirn schriftliche Informationen anders verarbeitet als Gedanken. Ebenso hilft es, Fortschritte regelmäßig zu teilen (z.B. indem sie im Übe-Tagebuch festgehalten werden), um ein gewisses Verantwortungsgefühl zu empfinden16. Wenn es egal ist, ob ich ein Ziel erreiche, dann wird die Motivation daran zu arbeiten eher geringer ausfallen.
Informationen selber aufzuschreiben erleichtert es, sich an sie zu erinnern und sie im Gedächtnis abzurufen. Dieses Phänomen ist zurückzuführen auf den Generation Effect17. Der Generation-Effect greift beim Aufschreiben gewissermaßen gleich doppelt: zunächst beim Erzeugen des Gedanken/Ziels im Kopf und dann nochmal durch eine erneute Verarbeitung beim Aufschreiben. Auf Papier und mit Hand aufzuschreiben scheint möglicherweise dazu zu führen, dass bestimmte Regionen im Gehirn stärker aktiviert und Informationen stärker enkodiert werden und besser abrufbar sind18.
SMARTE Ziele
Eine hilfreiche Methode beim Formulieren von Zielen ist die sogenannte SMART-Methode. Im Folgenden werden zunächst die Bedeutungen der einzelnen Buchstaben beschrieben. Anschließend findest du auch einige Beispiele, an denen du dich orientieren kannst7.
S = Spezifisch – Das Ziel sollte klar und verständlich formuliert sein. Es sollte klar sein, worum es geht und auf was sich das Ziel bezieht.
M = Messbar – Das Aufstellen eines Zieles bringt nichts, wenn nicht auch überprüft werden kann, ob dieses erreicht wurde.
A = Attraktiv – Damit ist gemeint, dass das Ziel eine bestimmte Relevanz für einen persönlich hat. Wenn es mir völlig egal ist, ob ich das Ziel erreiche oder nicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich mich nicht besonders ins Zeug legen werde, um das Ziel zu erreichen.
R = Realistisch – Das Ziel aber auch die Frist zur Erreichung desselben muss realistisch sein. Innerhalb einer Woche eine Sonate neu zu lesen und auf Konzertniveau vorzubereiten wäre selbst für erfahrene Konzertpianisten schwerz umsetzbar. Dass man sich insbesondere am Anfang mal etwas über- oder auch unterschätzt ist völlig normal. Ebenso können im Alltag selbstverständlich auch mal unvorhergesehene Verpflichtungen hinzukommen, weshalb man weniger Zeit zum Üben hat als zunächst angenommen.
T = Terminiert – Das Ziel muss auch mit einem Termin, also mit einer Frist, versehen sein. Es muss schließlich einen Punkt geben, an dem ich “messe”, also überprüfe, ob ich das Ziel erreicht habe oder nicht.
- Mosing MA, Verweij KJH, Hambrick DZ, Pedersen NL, Ullén F. Testing the Deliberate Practice Theory: Does Practice Reduce the Heritability of Musical Expertise? J Intell. September 2024;12(9):87.
- Bonneville-Roussy A, Bouffard T. When quantity is not enough: Disentangling the roles of practice time, self-regulation and deliberate practice in musical achievement. Psychol Music. September 2015;43(5):686–704.
- Hambrick DZ, Oswald FL, Altmann EM, Meinz EJ, Gobet F, Campitelli G. Deliberate practice: Is that all it takes to become an expert? Intelligence. Juli 2014;45:34–45.
- Lehmann AC, Ericsson KA. Research on expert performance and deliberate practice: Implications for the education of amateur musicians and music students. Psychomusicology J Res Music Cogn. 1997;16(1–2):40–58.
- Ericsson KA, Krampe RT, Tesch-Romer C. The Role of Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance. 1993;
- Bandura A, Cervone D. Self-evaluative and self-efficacy mechanisms governing the motivational effects of goal systems. J Pers Soc Psychol. November 1983;45(5):1017–28.
- BMI. SMART-Regel / SMART-Methode [Internet]. Bundesministerium des Innern. [zitiert 1. Juli 2025].
- Brandstätter V, Schüler J, Puca RM, Lozo L. Motivation und Emotion [Internet]. Berlin, Heidelberg: Springer; 2018 [zitiert 8. Februar 2024]. (Springer-Lehrbuch)
- Brandstätter V, Hennecke M. Ziele. In: Heckhausen J, Heckhausen H, Herausgeber. Motivation und Handeln [Internet]. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg; 2018 [zitiert 2. Juli 2025]. S. 331–53. (Springer-Lehrbuch)
- Rheinberg F, Vollmeyer R. Motivation. 9., erweiterte und überarbeitete Auflage. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer; 2019. 1 S. (Grundriss der Psychologie).
- Ryan RM, Deci EL. Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. Am Psychol. 2000;55(1):68–78.
- Berkeley S. The Motivational Dimensions of Self-Regulated Learning. Psychol Behav Sci Int J [Internet]. 26. August 2019 [zitiert 2. Juli 2025];13(1)
- Spitzer M. Musik im Kopf : Hören, Musizieren, Verstehen und Erleben im neuronalen Netzwerk [Internet]. Bd. 2. Auflage. [S.l.]: Schattauer; 2014 [zitiert 16. Februar 2024]
- Karnath HO, Thier P, Herausgeber. Neuropsychologie: mit 24 Tabellen ; [neu: Glossar]. 2., aktualisierte und erw. Aufl. Heidelberg: Springer Medizin; 2006. 763 S. (Springer-Lehrbuch)
- Zimmerman BJ, Schunk DH. Motivation: An essential dimension of self-regulated learning. In: Motivation and self-regulated learning: Theory, research, and applications. Mahwah, NJ, US: Lawrence Erlbaum Associates Publishers; 2008. S. 1–30.
- Matthews G. The Impact of Commitment, Accountability, and Written Goals on Goal Achievement. Psychol Fac Present [Internet]. 1. Januar 2007;
- Bertsch S, Pesta BJ, Wiscott R, McDaniel MA. The generation effect: A meta-analytic review. Mem Cognit. März 2007;35(2):201–10.
- Umejima K, Ibaraki T, Yamazaki T, Sakai KL. Paper Notebooks vs. Mobile Devices: Brain Activation Differences During Memory Retrieval. Front Behav Neurosci [Internet]. 19. März 2021 [zitiert 1. Juli 2025];15